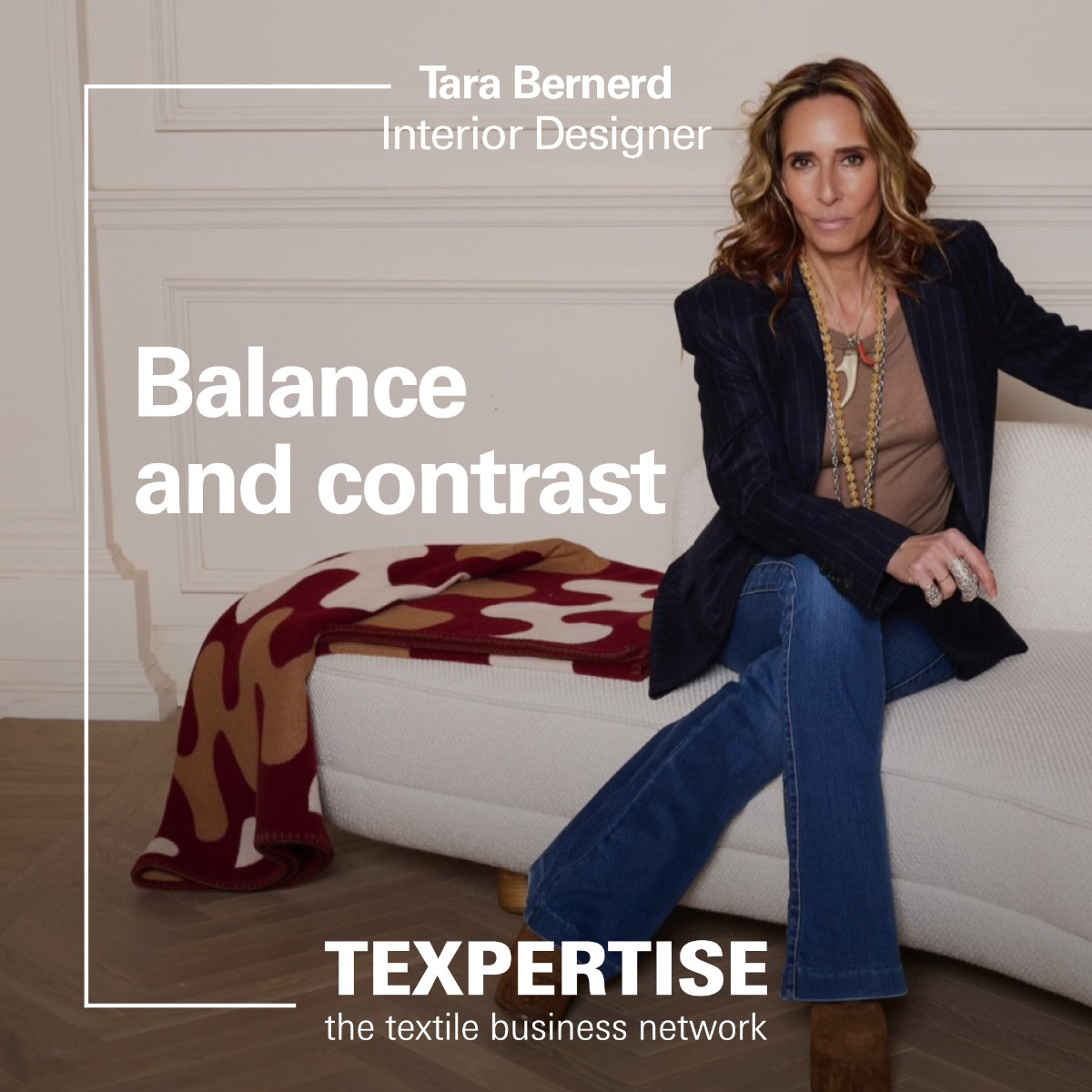Lesedauer: 5 Minuten
Die transparente Lieferkette: Eine globale Herausforderung
Ein einzelnes Textilprodukt durchläuft von der Herstellung bis zum Verkauf oft mehr als ein Dutzend Produktionsschritte und Zulieferstufen in verschiedenen Ländern. Diese Komplexität und die globale Vielfalt der Prozesse erklären, warum es für die Textilindustrie bisher so schwierig war, volle Transparenz in die eigene Lieferkette zu bringen. Dabei werden Transparenz (Transparency) und Rückverfolgbarkeit (Traceability) vom Rohstoff bis zum End-of-Life-Management in Zukunft entscheidend sein, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Denn nur wenn Unternehmen wissen, wo und unter welchen Bedingungen ihre Produkte hergestellt und verarbeitet werden, können sie gezielt Verbesserungsmaßnahmen anstoßen, um beispielsweise Umweltbelastungen in der Produktion zu reduzieren, faire Arbeitsbedingungen zu etablieren oder effiziente Recyclinglösungen zu entwickeln.
Steigender Transparenzdruck von allen Seiten
Der Druck auf die Unternehmen wächst. Denn Transparenz gewinnt nicht nur durch neue gesetzliche Anforderungen an Bedeutung. Auch Geschäftspartner*innen und Verbraucher*innen pochen zunehmend auf die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards. Eine Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) aus dem Jahr 2021 unterstreicht diese Entwicklung: Bereits zu diesem Zeitpunkt forderten 85 Prozent der Befragten, dass Textilunternehmen für Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten zur Verantwortung gezogen werden. Fast ebenso viele (84 Prozent) sprachen sich für verpflichtende Umweltstandards bei der Produktion im Ausland aus. Rund 9 von 10 Befragten wünschten sich zudem eine stärkere Kontrolle von Nachhaltigkeitssiegeln.1
Die Textilindustrie hat auf solche Forderungen mit verschiedenen Instrumenten reagiert. In Brancheninitiativen wie dem „Bündnis für nachhaltige Textilien“ (BNT) arbeiten Unternehmen, Verbände, Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften gemeinsam an der Verbesserung von Sozial- und Umweltstandards entlang der textilen Lieferkette. Vor allem auch das Unglück von Rana Plaza im Jahr 2013, ein entscheidender Wendepunkt für die Textilindustrie, führte zum Auf- und Ausbau zahlreicher Sozialstandards sowie zur Gründung der „Fashion Revolution“ – einer internationalen Bewegung, die mit der Initiative „Who Made My Clothes?“ das Bewusstsein für faire Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie weltweit schärft.
Zertifikate wie der Global Organic Textile Standard (GOTS) oder OEKO-TEX® MADE IN GREEN setzen bereits heute auf mehr Transparenz und bessere Nachweise für sozial- und umweltverträgliches Handeln. Ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz wird voraussichtlich ab 2026 auch der digitale Produktpass (DPP) sein, der umfassende Produktinformationen zu Herkunft, Materialien, Umwelt- und Sozialstandards, Reparatur- und Recyclingfähigkeit elektronisch verfügbar machen soll.
Blockchain, Big Data und KI: Digitale Werkzeuge für mehr Transparenz
Textilunternehmen sind also vielfach gefordert, die Herstellungswege ihrer Produkte transparenter zu machen und ihre Lieferketten offenzulegen. Die zentrale Frage dabei: Wie bringt man Transparenz in eine der komplexesten Lieferketten der Welt? Die Lösung liegt zunehmend in der Digitalisierung. Schon heute setzen Textilunternehmen auf Tools rund um Blockchain, Big Data und IoT-Sensoren, um beispielsweise die Herkunft von Faserrohstoffen zurückzuverfolgen, Daten aus der Lieferkette zu analysieren oder um die Nachhaltigkeitsleistung von Produktionsstätten und Lieferanten digital im Blick zu behalten.
Mittels Produkt-IDs und QR-Codes erhalten Verbraucher*innen und Handel Einblick in die Entstehungsgeschichte und die globalen Lieferwege ihrer Textilprodukte. Insbesondere von den jüngsten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz versprechen sich viele einen Schub für die textile Transparenz. „KI ist Teil unserer Zukunft und wird bereits von zukunftsorientierten Textilunternehmen und Marken eingesetzt“, sagt EURATEX-Generaldirektor Dirk Vantyghem. KI könne der Textilindustrie helfen, Produktionsmengen zu planen, die enormen Datenmengen der textilen Lieferkette zu erfassen sowie das Konsumverhalten zu bewerten, so Vantyghem. Der EURATEX-Chef ist überzeugt: „Wir müssen den Digitalisierungsprozess in unserer Branche konsequent vorantreiben, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“
Herausforderungen auf dem Weg zur digitalen Lieferkette
Doch rund um die Verknüpfung der Fäden in der Cloud gibt es noch viel zu tun. Es müssen Wege gefunden werden, die Vielzahl der Daten aus Rohstoffgewinnung, Produktion und Transport, die oft in unterschiedlichen Formaten vorliegen, plattformübergreifend einheitlich zu erfassen. Dies erfordert neben Kooperationen zur Datenerhebung und -nutzung auch Schulungs- und Förderprogramme, damit die digitalen Werkzeuge von allen Akteur*innen der textilen Wertschöpfungskette – vom internationalen Modelabel bis zum lokalen Lieferanten – genutzt werden können. Dazu ist nicht nur der Ausbau der digitalen Infrastruktur – vor allem auch in den Produktionsländern – notwendig, sondern auch eine gleichberechtigte Teilhabe zu angemessenen Kosten.
Wenn die „digitalen Fäden“ von TIER 4 bis TIER 0 für alle Beteiligten nutzbar sind, kommt mehr und mehr Licht in die Blackbox Lieferkette. Ein zusätzlicher Anreiz dabei: Mehr Transparenz kann den Textilunternehmen helfen, Optimierungspotenziale besser zu erkennen, um künftig schneller auf Risiken und Marktentwicklungen reagieren zu können.
Key Learnings
- Herausforderung Transparenz in komplexen Lieferketten Die Komplexität der textilen Lieferkette macht Transparenz und Rückverfolgbarkeit zur Herausforderung. Diese sind essenziell, um Umweltbelastungen zu reduzieren, faire Arbeitsbedingungen sicherzustellen und Recyclinglösungen zu etablieren.
- Steigende Anforderungen durch Regulierungen und nachhaltigen Konsum Neue gesetzliche Anforderungen wie der digitale Produktpass und nachhaltigere Konsumentscheidungen verlangen von Unternehmen die Offenlegung von Lieferketten.
- Digitale Technologien als Werkzeug Technologien wie Blockchain, Big Data und KI sind entscheidend für die Nachverfolgung von Rohstoffen, die Analyse großer Datenmengen und die Planung nachhaltiger Produktionsprozesse. Daten sollten plattformübergreifend einheitlich erfasst und eine digitale Infrastruktur allen Akteur*innen zugänglich sein.
Quellen:
1 Verbraucherzentrale Bundesverband, 2021, „Umfrage: Verbraucher für starkes Lieferkettengesetz“.