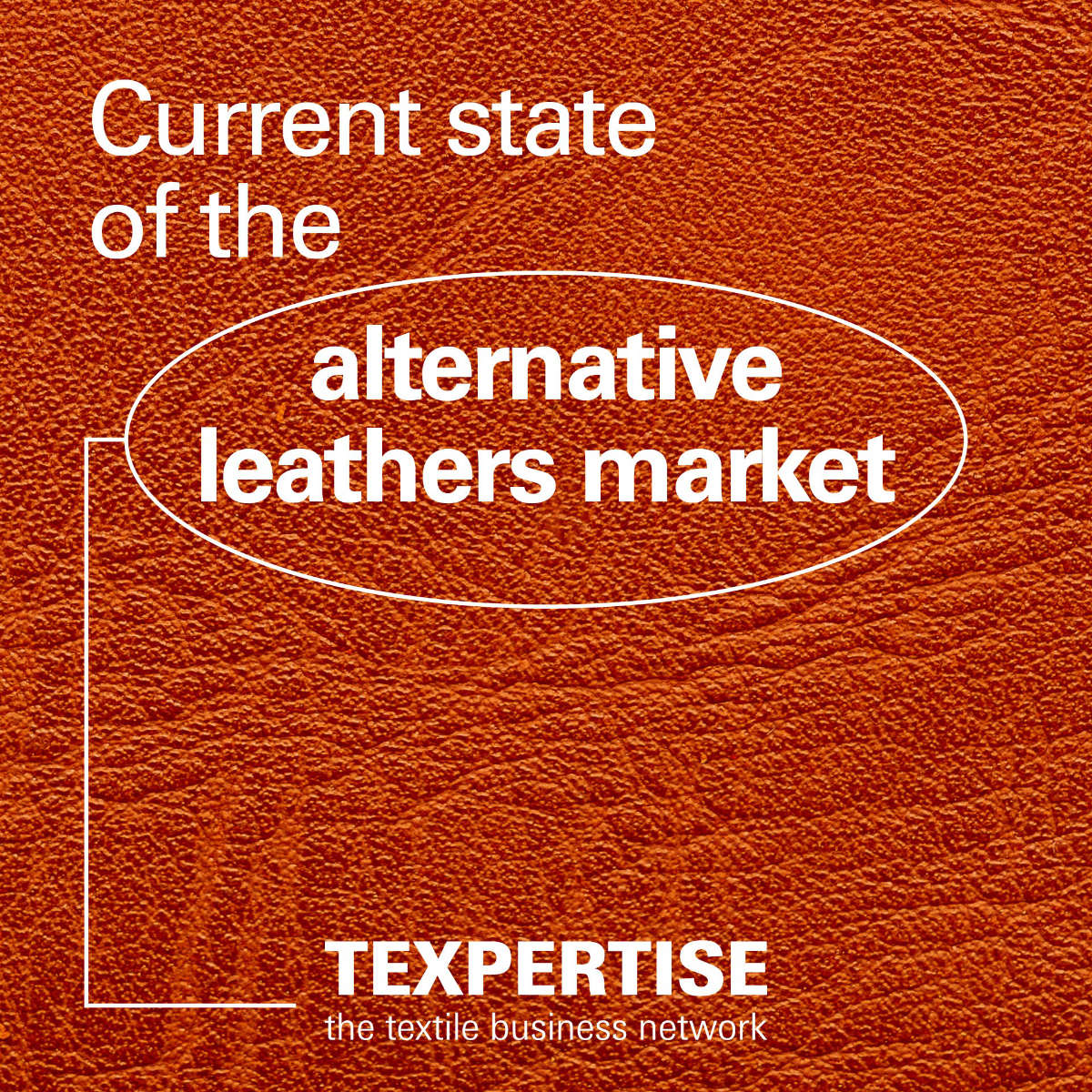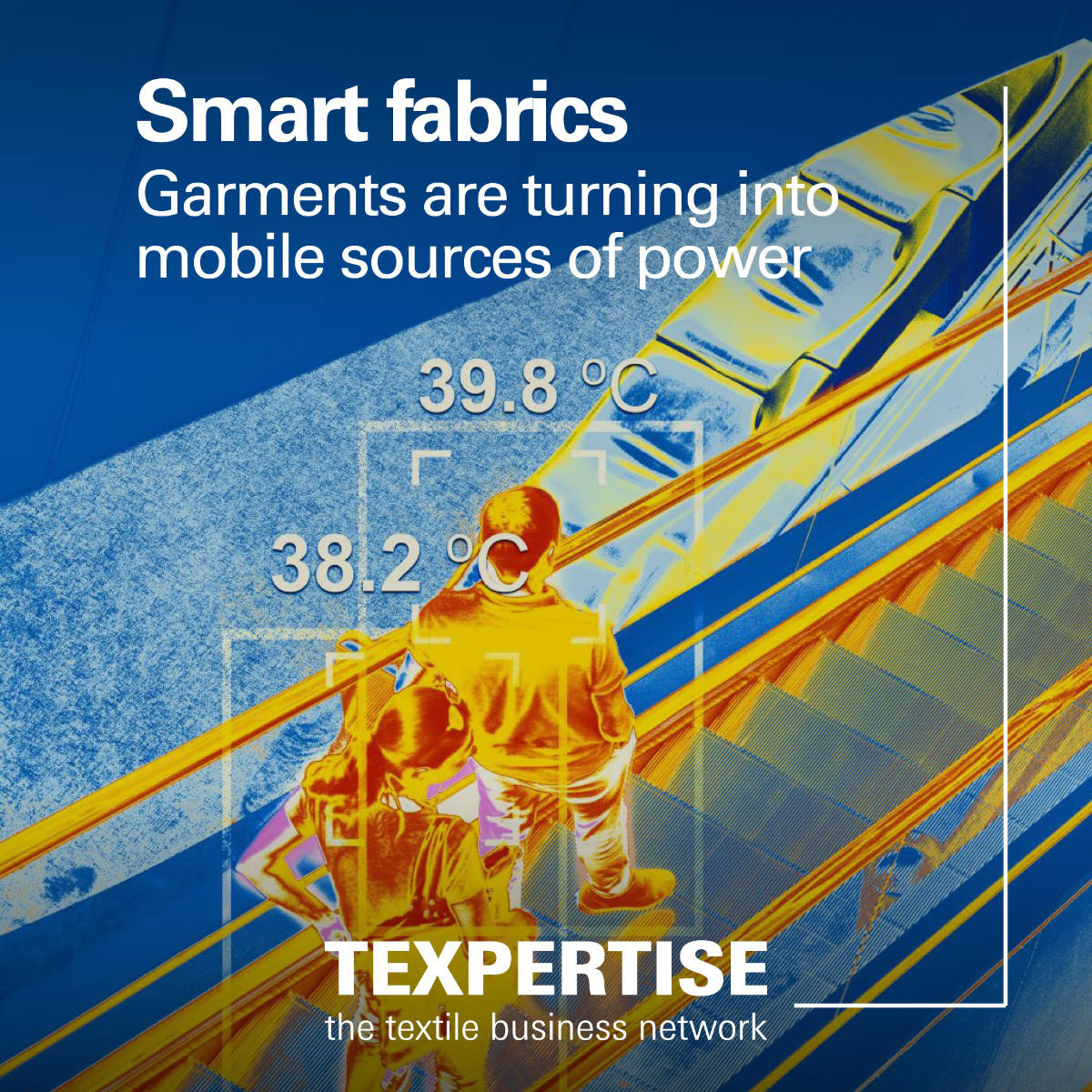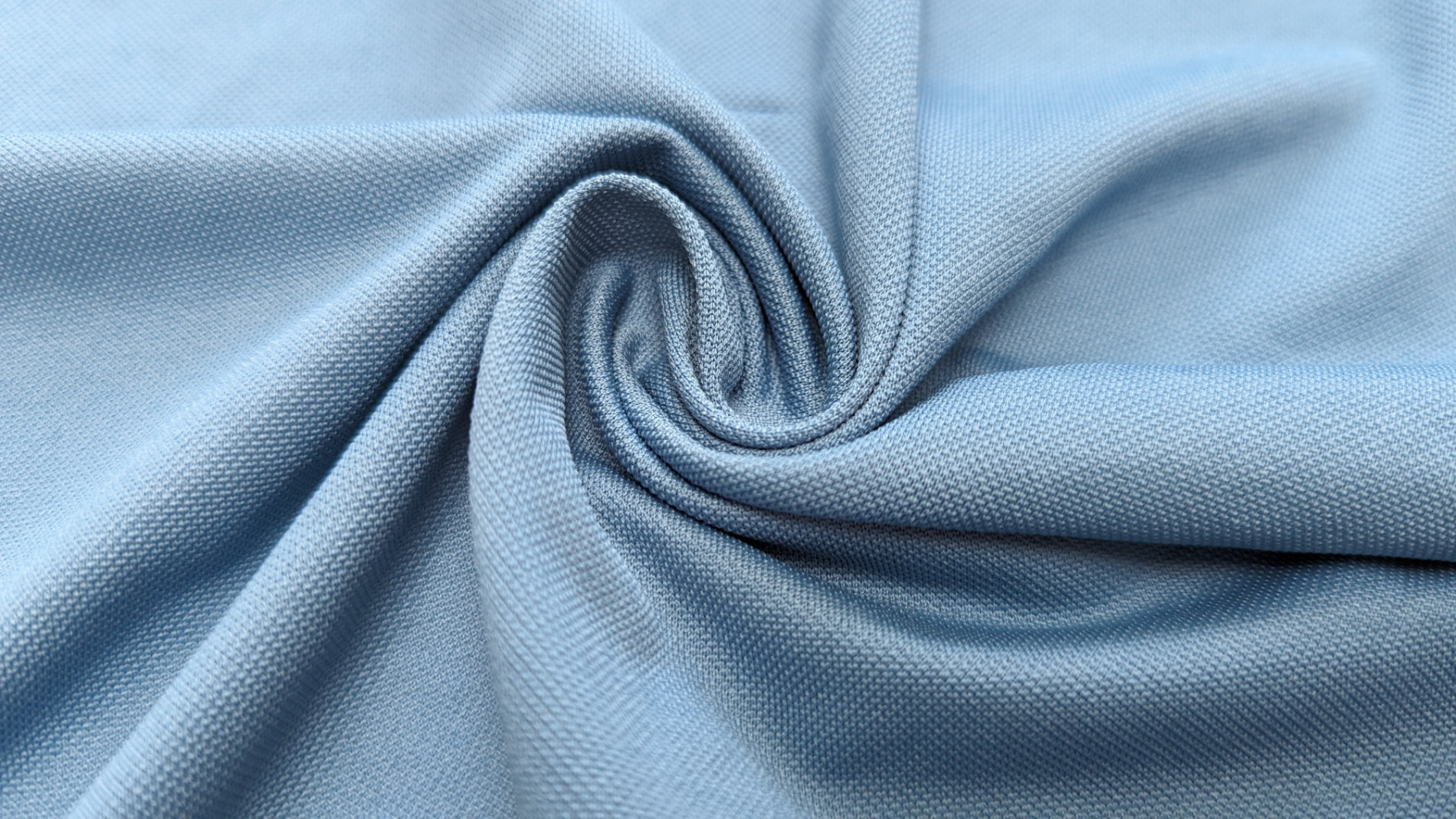Lesedauer: 4 Minuten
Unter Verwendung von Elektroden in flüssiger Form hat das Team eine „weiche und angenehme“ Batterie geschaffen, die sich in Textilien integrieren lässt. In der Fachzeitschrift „Science Advances“ berichten die Forschenden, dass das Material beispielsweise in einem 3D-Drucker eingesetzt werden kann, um die Batterie nach Wunsch zu formen und so den Weg für eine völlig neue Technologie ebnet.
Aiman Rahmanudin, Assistenzprofessor an der Linköping-Universität erklärt: „Die meisten dehnbaren oder tragbaren Batterien basieren heute auf festen Komponenten, die in ausgeklügelten Geometrien angeordnet sind – wie Schlangenlinien, Netzstrukturen, eingebettete Inseln im Gummi oder als Verbund mit Elastomeren. Diese Konstruktionen können sich zwar dehnen, doch letztlich skaliert die Kapazität nach wie vor mit dem Volumen.“

Die Entwicklung flexibler Batterien

Die Arbeit von Rahmanudin und seinen Kolleg*innen am Laboratory of Organic Electronics stellt einen Paradigmenwechsel dar: Anstelle fester Elektroden kommen „redoxaktive Flüssigkeiten“ zum Einsatz, wodurch die Kapazität unabhängig von den mechanischen Eigenschaften wird. Dies, so Rahmanudin, eröffne die Möglichkeit einer „nahtlosen Integration in Kleidungsstücke, ohne Weichheit oder Tragekomfort zu beeinträchtigen“ und ermögliche somit völlig neue, bislang undenkbare tragbare Formfaktoren.
Der Schlüssel zu dieser Forschung war die Umwandlung von Elektroden aus fester in flüssige Form.
Durch den Einsatz eines flüssigkeitsbasierten Elektroden-Systems, in dem Energiespeichermaterialien in einem „dicken, pastenartigen Elektrolyten“ verteilt sind – Rahmanudin vergleicht dessen Konsistenz mit Zahnpasta – entsteht eine aktive Elektrode. Diese wird zwischen weichen Schichten eingefügt und in dehnbares Verpackungsmaterial eingebettet.
Dadurch verhält sich die Batterie eher wie eine textile Lage als wie ein festes Bauteil, das auf Kleidungsstücke aufgenäht wird.
Die Materialien speichern und geben Energie durch Redoxreaktionen ab, ganz wie in herkömmlichen Batterien.
Mit zunehmender Komplexität tragbarer Technologien in den Bereichen Gesundheitswesen und E-Textilien erkannte Rahmanudin die Chance und Notwendigkeit, Elektronik so zu gestalten, dass sie sich biegen, dehnen und mit dem menschlichen Körper bewegen kann. Batterien zählen jedoch traditionell zu den starrsten Komponenten.
„Unsere Forschung wurde durch die Notwendigkeit motiviert, das Batteriedesign von Grund auf neu zu denken – nicht nur, um es dehnbar zu machen, sondern damit es fließt“, erklärt er. Dies sei erforderlich, wenn wir über Geräte hinausgehen wollen, die am Körper befestigt werden, hin zu integrierter Elektronik wie intelligente Shirts oder therapeutische Kleidungsstücke. Die Energiequelle müsse daher die Weichheit und Flexibilität des Gewebes übernehmen.
„Auch wenn wir ihre Integration in Textilien nicht demonstriert haben, war unser Ziel, den Machbarkeitsnachweis einer Flüssigbatterie zu erbringen, die breit in einer Vielzahl von tragbaren Geräten eingesetzt werden könnte“, fügt Rahmanudin hinzu.
Die zu überwindende Herausforderung

Nach Schätzungen der Linköping-Universität werden in zehn Jahren mehr als eine Billion Geräte mit dem Internet verbunden sein.
In einer Pressemitteilung erklärte die Universität, dass dies neben herkömmlicher Technologie auch medizinische Geräte und Sensoren umfassen könne – langfristig sogar weiche Robotik, E-Textilien und vernetzte Nervenimplantate.
Eine der „größten Herausforderungen“ für das Forschungsteam bestand darin, die elektrochemische Leistung bei der Verwendung weicher, verformbarer Materialien aufrechtzuerhalten.
Rahmanudin erläutert: „Als wir auf flüssige Elektroden umgestiegen sind, mussten wir die Formulierung sorgfältig entwickeln, um sicherzustellen, dass die aktiven Partikel während wiederholter Bewegungs- und Veränderungszyklen gut dispergiert, leitfähig und stabil bleiben.“
„Eine weitere Herausforderung war es, Flüssigkeitswanderungen zu verhindern, was wir durch Verkapselungstechniken und rheologische Anpassungen gelöst haben,“ ergänzt er.
Da die Elektrode jedoch aus einer dicken Paste besteht, haben die Forschenden die Haltbarkeit getestet, um sicherzustellen, dass sie Dehnungen und mechanischer Belastung standhält, ohne zu reißen. Die Batterien wurden bisher zwar noch nicht auf Waschbarkeit geprüft, doch die langfristige Vision ist eine nahtlose Integration, „bei der Batterien auch sanfte Waschzyklen in intelligenten Kleidungsstücken überstehen können.“
What’s next?
3D-Druck: „Dies ermöglicht maßgeschneiderte Batterieformen, die sich der Geometrie von Kleidungsstücken oder Körperkonturen anpassen,“ sagt Rahmanudin. „Noch wichtiger ist, dass der 3D-Druck eine gezielte Ablagerung der Batterie genau dort erlaubt, wo sie benötigt wird – etwa am Ärmel, Kragen oder sogar innerhalb eines Faserbündels.“
Die Forschenden hoffen, dass dies vollständig integrierte Energiesysteme in Textilien ermöglicht. Ihre langfristige Vision ist es, eine komplette Plattform für weiche Energiesysteme zu entwickeln – von druckbaren Tinten bis hin zu vollständig integrierten tragbaren Batterien.
Darüber hinaus hat das Team damit begonnen, Möglichkeiten zur Verbesserung der Energiedichte sowie zur Maximierung des Einsatzes nachhaltiger Materialien zu untersuchen. Rahmanudin möchte zudem mit Designer*innen, Ingenieur*innen und Textilherstellern zusammenarbeiten, um diese Innovation aus dem Labor hinaus in die Praxis zu bringen.
„Das ebnet den Weg für die nächste Generation smarter Kleidung,“ sagt Rahmanudin. „In der Mode eröffnet es Möglichkeiten für Kleidungsstücke, die leuchten, ihre Form verändern oder Sensorfunktionen übernehmen – ohne Einbußen beim Tragekomfort.“
Autorin: Abigail Turner, WTiN