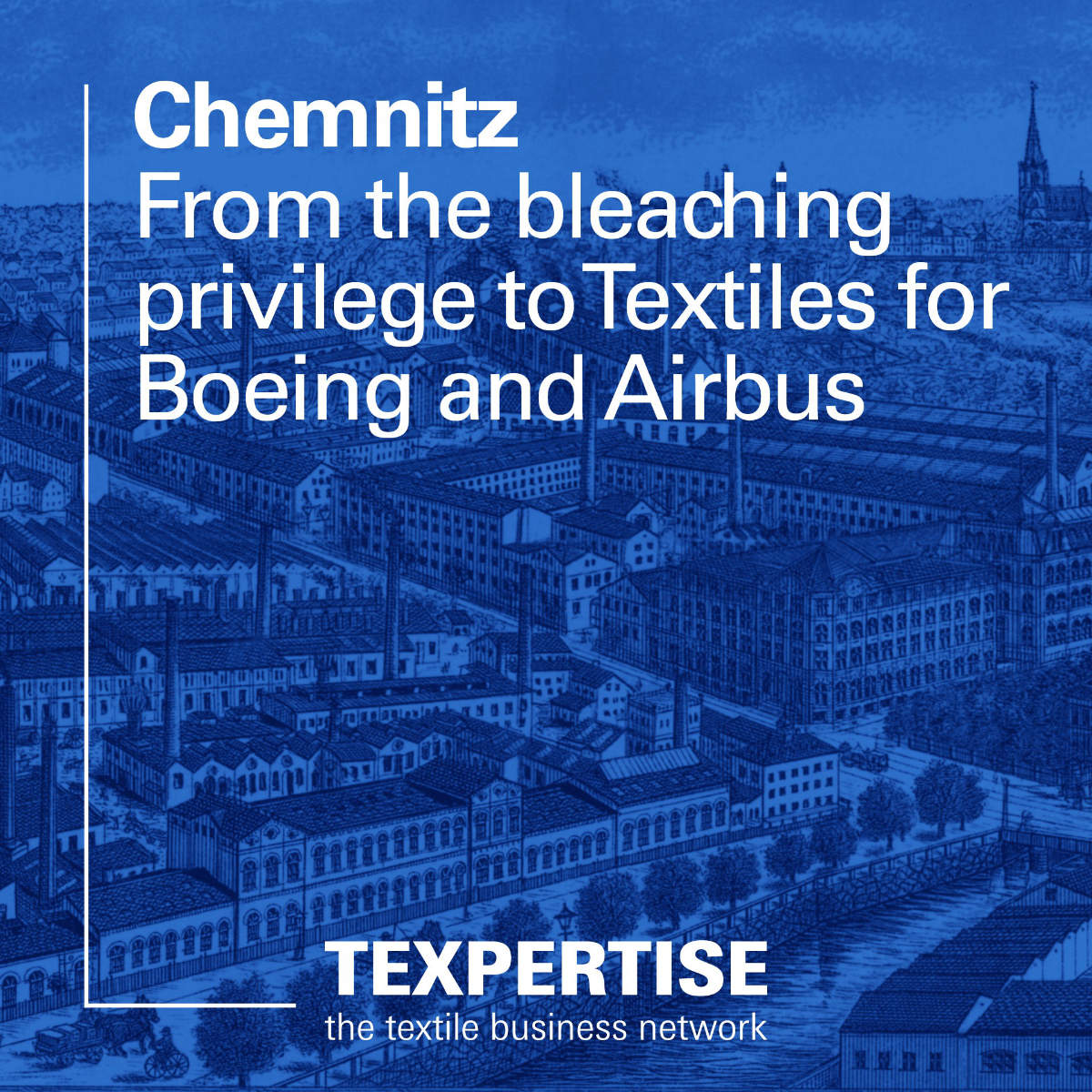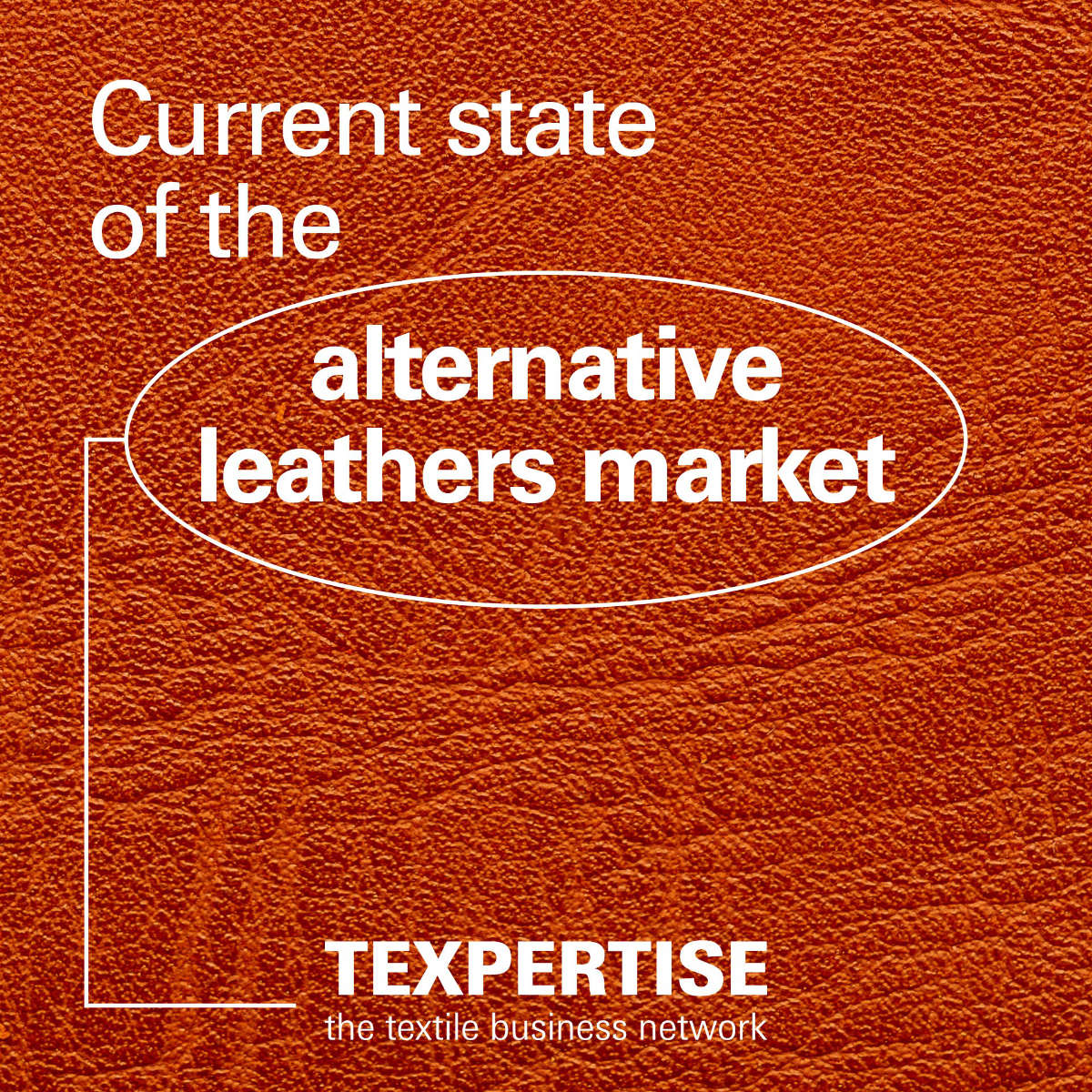Lesedauer: 6 Minuten
Die 1-Prozent-Herausforderung
Die größte Herausforderung für die Textil- und vor allem Bekleidungsindustrie auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft verbirgt sich hinter einer kleinen Zahl: Nur 1 Prozent1 der Kleidung weltweit wird wieder zu neuer Kleidung verarbeitet, also in einem geschlossenen Kreislauf eines Faser-zu-Faser-Recyclings wiederverwertet. Eine weitere Zahl verdeutlicht die gigantische Herausforderung, vor der das Textilrecycling steht: 148 Millionen Tonnen. Das ist die Menge an Abfällen an Bekleidung, die bis 2030 schätzungsweise weltweit pro Jahr anfällt.2
Zur Veranschaulichung: Das entspricht etwa dem Gewicht von rund 370.000 voll beladenen Airbus A380. Obwohl eine genaue Aufschlüsselung nach Abfallarten schwierig ist, umfasst die Zahl vermutlich sowohl Pre- und Post-Consumer-Abfälle als auch Second-Hand-Ware, die sortiert und entweder wiederverwendet, recycelt oder entsorgt wird.
Das Recycling-Paradox
Henning Wilts, Leiter der Abteilung Kreislaufwirtschaft am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie, bringt das Recycling-Paradox auf den Punkt: „In kaum einer anderen Branche klaffen Potenzial und Realität der Zirkularität so weit auseinander wie in der Textilindustrie.“ Die Gründe dafür sind vielfältig: komplexe Materialmischungen aus Chemie- und Naturfasern, die sich nicht oder nur mit hohem Energieaufwand auftrennen lassen; eine Verschlechterung der Faserqualität im Recyclingprozess, etwa beim mechanischen Recycling; höhere Kosten von Recyclingprodukten im Vergleich zu Neuware und fehlende Anreize in der Herstellung, Rezyklate statt Originalfasern zu verwenden.
Darüber hinaus ist die Recyclingkette von der Sammlung bis zur Verwertung fragmentiert und weitgehend manuell, was effiziente Prozesse erschwert. In der Folge wird der größte Teil der Alttextilien als Second-Hand-Ware (hauptsächlich Kleidung) exportiert, auf Deponien gelagert, verbrannt oder mechanisch zu Putzlappen, Dämmstoffen und Füllmaterial für Polstermöbel downgecycelt.
Einige dieser Lösungen, insbesondere das mechanische Recycling, tragen damit zwar bereits zur Einsparung von Primärfasern bei. Doch um textile Ressourcen in großem Umfang in den Faser-zu-Faser-Kreislauf zu bringen, ist noch deutlich mehr erforderlich.
Der Transformationsdruck wächst
Zumal der Handlungsdruck wächst. Denn zum einen setzt die Übersättigung mit minderwertigen Textilien das Geschäftsmodell der Alttextilverwertung unter Druck. Traditionelle Exportmärkte wie Afrika schränken längst die Einfuhr von Second-Hand-Ware ein. Ostafrikanische Länder wie Ruanda, Tansania, Uganda und Burundi haben bereits Importbeschränkungen für Second-Hand-Kleidung erlassen, um die heimische Textilindustrie zu stärken. Zum anderen erhöhen steigende Rohstoffpreise und EU-Vorgaben den Transformationsdruck: Ab 2025 setzen die verpflichtende Getrenntsammlung, die erweiterte Herstellerverantwortung sowie die für 2025 geplante Ökodesign-Verordnung mit digitalem Produktpass verbindliche Standards für die Produktverantwortung und eine nachhaltige Recyclingwirtschaft.
Wege in die Kreislaufwirtschaft
Der Schlüssel für einen funktionierenden Faser-zu-Faser-Kreislauf dürfte in einer Kombination verschiedener Lösungsansätze liegen: Recyclinggerechtes und zirkuläres Produktdesign, das Materialmischungen vermeidet und – als Königsweg – auf hochwertige Monomaterialien setzt.
Ohnehin gilt das Design als ein treibender Faktor der Transformation, denn bis zu 80 Prozent der Umweltauswirkungen eines Produkts werden in der Designphase festgelegt – hier entscheidet die Wahl der Materialien, der Verarbeitungstechniken und der Konstruktion nicht nur über die spätere Langlebigkeit und Reparierbarkeit, sondern auch über die Recyclingfähigkeit des Produkts. Neben dem Design spielen auch technologische Innovationen eine zentrale Rolle, etwa intelligente Sortieranlagen, die neben Robotern und Automatisierungstechnik auch KI, maschinelles Lernen und Nahinfrarotspektroskopie (NIR) nutzen, um Mischtextilien und Accessoires wie Knöpfe, Aufnäher und Reißverschlüsse besser zu trennen.
Der Aufbau einer flächendeckenden Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastruktur ist ebenso wichtig wie die digitale Integration der Wertschöpfungskette mit aufeinander abgestimmten Abfallströmen und einer Datenkommunikation, die den Recyclingunternehmen die richtigen Rohstoffe mit den notwendigen Informationen über deren Zusammensetzung liefert. Wenn verbindliche Vorgaben für höhere Rezyklatanteile kommen, muss auch die Frage beantwortet werden, wie diese überprüft werden können. Darüber hinaus müssen etablierte Recyclingverfahren wie das mechanische Recycling weiterentwickelt werden, um die Faserqualität für einen hochwertigen Faser-zu-Faser-Kreislauf zu erhalten. Auch neue Recyclingverfahren müssen entwickelt werden, wie in jüngster Zeit das chemische Recycling, bei dem Alttextilien mit Hilfe von Chemikalien in ihre Grundbausteine zerlegt und zu neuen Fasern verarbeitet werden (Depolymerisation).
Gerade vom chemischen Recycling versprechen sich viele höhere Recyclingquoten bei gleichzeitig hoher Faserqualität. Im Gegensatz zum mechanischen Recycling steht das Verfahren jedoch noch am Anfang der industriellen Umsetzung. „Eine Kreislaufwirtschaft wird häufig als eine Industrie dargestellt, die in großen Kreisläufen funktioniert. Tatsächlich besteht eine Kreislaufwirtschaft jedoch aus vielen kleinen, zirkulären Ansätzen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette umgesetzt werden“, sagt Wissenschaftler Wilts.
Ohne bewussteren Konsum funktioniert der Kreislauf nicht
Dass für einen dauerhaften Wandel die technologische Weiterentwicklung allein nicht ausreichen wird, betont Johannes Leis: „Investitionen in neue Sortier- und Recyclingverfahren und in kreislauffähige Textilprodukte lohnen sich nur, wenn auch die Nachfrage da ist“, sagt der Textilforscher vom Sächsischen Textilforschungsinstitut (STFI) in Chemnitz. Der jahrelange Preisdruck bei Sekundärrohstoffen habe eine Verbesserung der Rezyklatqualität verhindert, erklärt der Recyclingexperte.
Er ist überzeugt: Ohne bewusstere Konsumentscheidungen funktioniert der Kreislauf nicht. Zwar spreche sich in Umfragen häufig eine Mehrheit für nachhaltige Produkte aus, doch die konkrete Kaufentscheidung falle angesichts höherer Preise oftmals anders aus. „Die Unternehmen müssen neue nachhaltige Textilangebote schaffen, aber auch die Konsument*innen müssen alte Gewohnheiten überdenken und Kleidung bewusster kaufen, länger tragen, besser pflegen und fachgerechter entsorgen“, so der STFI-Forscher. Ein ermutigendes Umdenken in Richtung Langlebigkeit textiler Produkte zeigt sich für ihn in neuen Geschäftsmodellen rund um das Leihen und Reparieren von Schuhen und Bekleidung. „Die technologischen Ansätze für das Recycling und die kreislauforientierten Produkte und Geschäftsmodelle müssen jetzt gemeinsam durch Politik, Forschung, Unter-nehmen und nicht zuletzt durch die Kaufentscheidungen der Konsument*innen am Markt etabliert werden“, sagt Leis.
Die Texpertise Econogy Insights zum Textilrecycling
Übergreifende Ergebnisse
- Recycelte Materialien sind messeübergreifend die wichtigste Kategorie in den Econogy Checks.
- GRS und recyceltes PES/PET führen.
Stärkste Präsenz auf Heimtextil
- Mit über 698 recycelten Materialien ist die Heimtextil führend im Bereich der recycelten Materialien.
- Der stärkste Fokus lag auf GRS-zertifizierten Materialien (171 Aussteller), recyceltem PES/PET (148 Aussteller) und recycelter Baumwolle (119 Aussteller).
Bedeutende Rolle auf Techtextil
- Mit insgesamt 287 recycelten Materialien setzt die Techtextil ein deutliches Signal, dass Recyclingmaterialien auch im Bereich technische Textilien eine wachsende Bedeutung haben. Besondere Schwerpunkt bildeten recyceltes PES/PET (78 Aussteller) und GRS (56 Aussteller).
Nachhaltige Ausrichtung der Intertextile Shanghai Apparel Fabrics
- 253 Produkte mit Recyclingfokus machen die Intertextile zum wichtigsten Textilrecycling-Hub Asiens.
Key Learnings
- Geringe Recyclingquote und Herausforderungen
Nur 1% der weltweit produzierten Kleidung wird im Faser-zu-Faser-Recyclingprozess zu neuer Kleidung verarbeitet. Komplexe Materialmischungen, niedrige Faserqualität und hohe Kosten von Recyclingprodukten im Vergleich zu Neuware erschweren den Recyclingprozess.
- Wachsender Druck für Transformation
Steigende Rohstoffpreise, gesetzliche Vorgaben und Einschränkungen im Export von Second Hand-Ware verlangen nach Lösungen.
- Notwendigkeit für eine ganzheitliche Lösung
Erfolgsfaktoren für die Kreislaufwirtschaft sind ein recycling-gerechtes Design, neue Technologien, eine verbesserte Recycling-Infrastruktur und ein bewussterer Konsum.