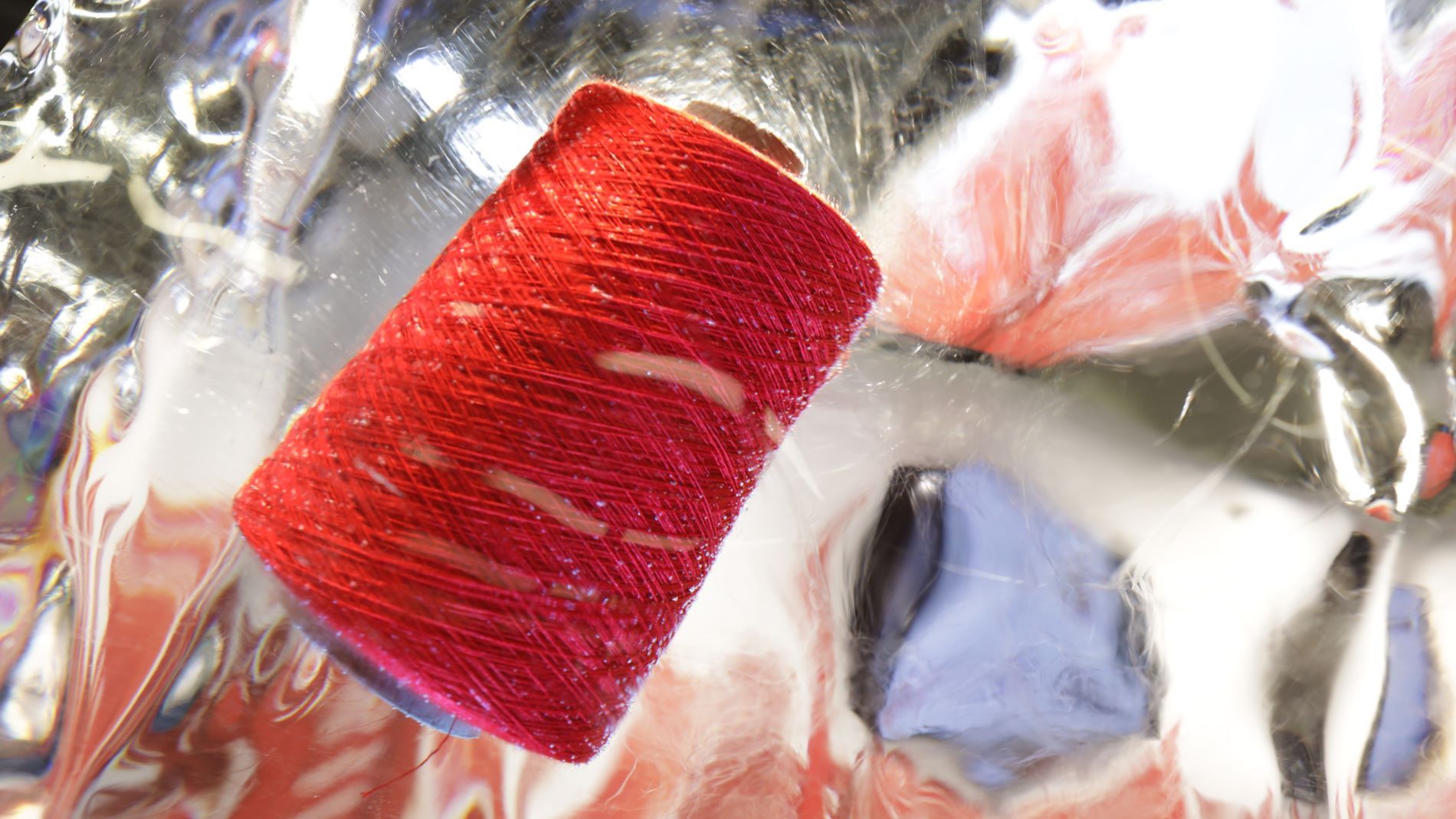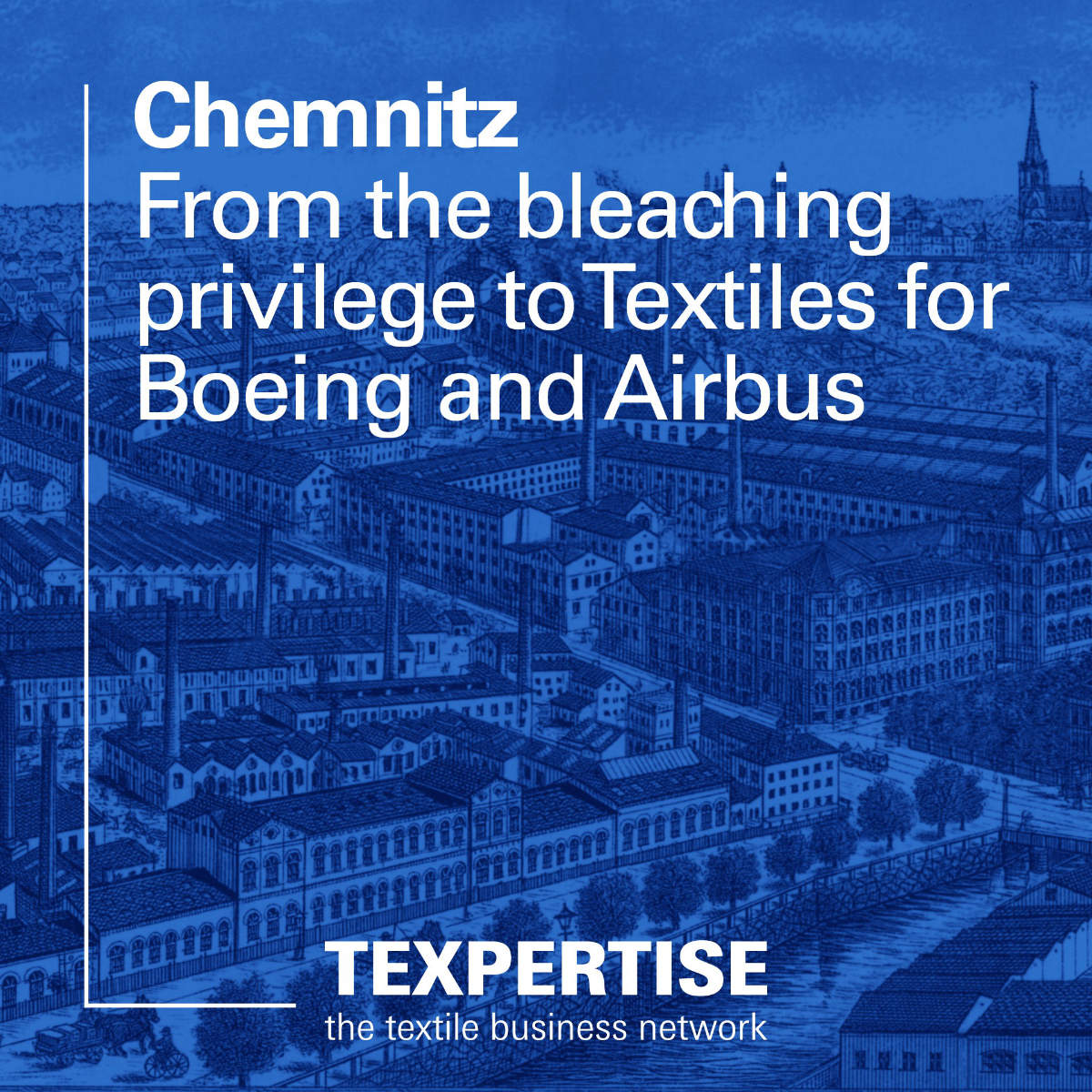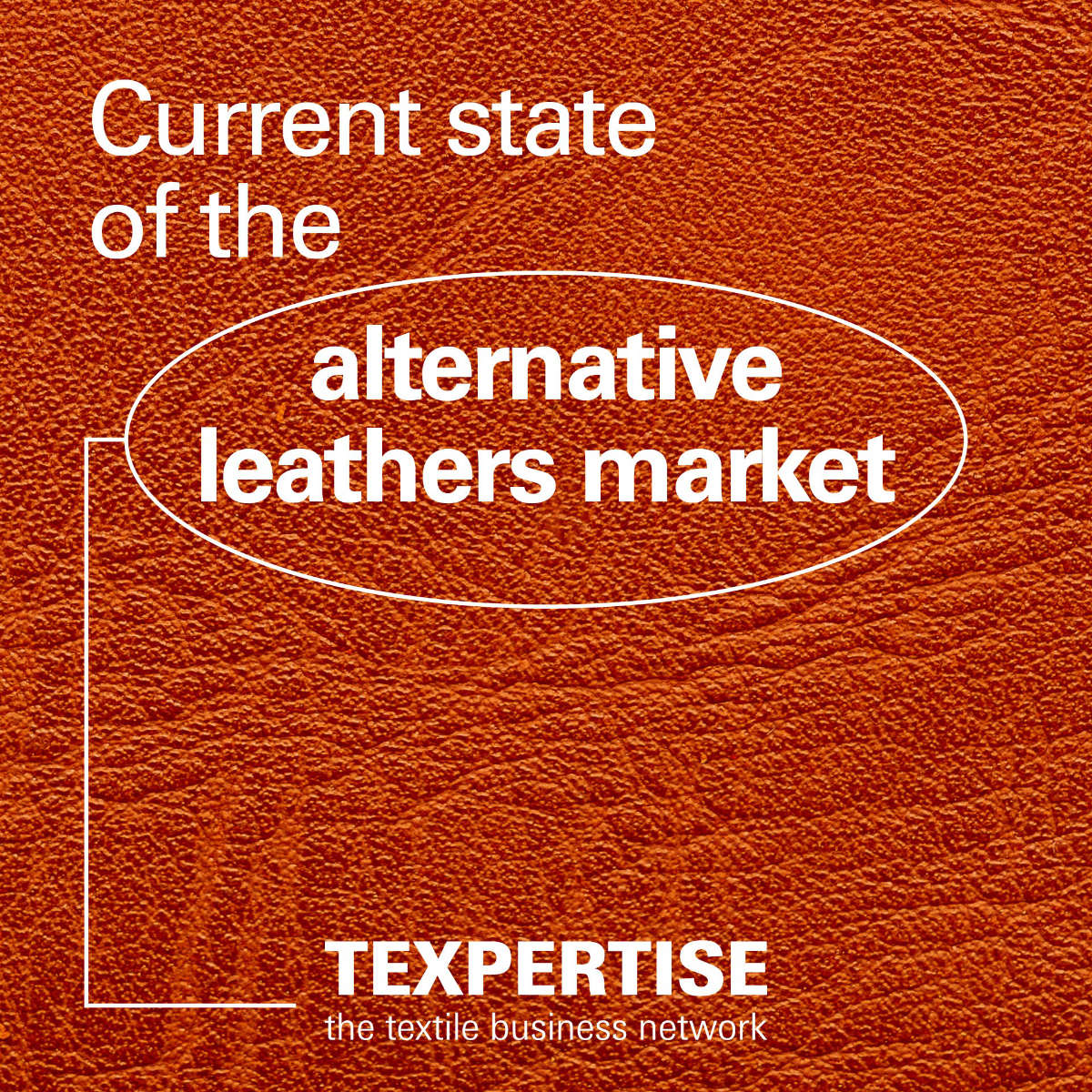Lesedauer: 7 Minuten
Chemiefasern prägen den Markt
Laut dem Materials Market Report 2024 von Textile Exchange erreichte die weltweite Faserproduktion im Jahr 2023 mit 124 Millionen Tonnen einen neuen Höchststand. Hält der Trend an, werden bis 2030 160 Millionen Tonnen erwartet. Polyester bleibt mit einem Anteil von 57 Prozent die meistproduzierte Faser.1 Die Gründe für die „synthetische Führungsrolle“ sind bekannt: hoch verfügbar, vielseitig einsetzbar, kostengünstig. Ihre niedrigen Produktionskosten machen Chemiefasern nach wie vor zum bevorzugten Material für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie finden sich nicht nur in Alltagskleidung und Heimtextilien, sondern auch in Sicherheitsgurten, Airbags, Filtern, in chirurgischem Nahtmaterial, Gefäßprothesen und in der heute besonders beliebten funktionellen Outdoorbekleidung. Doch die ökologischen Nachteile wiegen schwer: Chemiefasern basieren auf fossilen Rohstoffen, ihre Herstellung ist energie- und CO2 -intensiv, sie sind schwer abbaubar und setzen Mikroplastik frei.
Zwar werden zunehmend auch recycelte Chemiefasern eingesetzt, zum Beispiel recyceltes Polyamid (Nylon), das aus Industrieabfällen, alten Teppichen und ausrangierten Fischernetzen gewonnen wird, oder recyceltes Polyester (rPET). Beide tragen im Vergleich zu neuen („virgin“) Chemiefasern auch durchaus zur Entlastung der Umwelt bei. Aber auch sie sind nicht biologisch abbaubar und setzen Mikroplastik frei. Ein weiteres Dilemma: Der größte Teil des rPET stammt nicht aus einem geschlossenen Textilkreislauf, sondern aus recycelten PET-Flaschen. Dieses branchenfremde Recycling entspricht jedoch nicht dem Ziel einer textilen Kreislaufwirtschaft. Ein hochwertiges Faser-zu-Faser-Recycling, bei dem Alttextilien aus Polyester zu neuen Textilfasern verarbeitet werden, findet bisher kaum statt. Hier stellen vor allem die heute üblichen Mischfasertextilien die Industrie vor große Herausforderungen. Doch die Textilbranche arbeitet an Lösungen: Biobasierte Kunststoffe wie PLA (Polylactide) aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais oder Zuckerrohr sind eine Option. Sie sind zwar nicht automatisch biologisch abbaubar, haben aber ähnliche Eigenschaften wie herkömmliche Chemiefasern und können auf denselben Maschinen verarbeitet werden. Darüber hinaus produzieren Textilunternehmen Polyesteralternativen, die einerseits weitgehend biologisch abbaubar sind und andererseits in Bezug auf Haltbarkeit und Leistung mit herkömmlichem Polyester konkurrieren können. Parallel dazu wird an Farbstoffen auf pflanzlicher Basis gearbeitet, die langfristig auch den Einsatz von Chemiefasern nachhaltiger machen könnten.
Naturfasern: Vom Trend zum Standard?
Während die Textilindustrie nach Lösungen für die ökologischen Herausforderungen im Zusammenhang mit Chemiefasern sucht, stellt sich die Frage: Können Naturfasern der Schlüssel zu einer nachhaltigeren Textilindustrie sein? Zwar sind Naturfasern aufgrund längerer Herstellungsprozesse und klimatischer Abhängigkeiten oft weniger wirtschaftlich als Chemiefasern, doch punkten sie mit entscheidenden Nachhaltigkeitsvorteilen: Sie wachsen nach, sind biologisch abbaubar und frei von Mikroplastik. Zudem binden sie CO2 und ermöglichen geschlossene Kreisläufe. Doch der Blick auf die Produktionszahlen ernüchtert: Auch wenn Baumwolle, weltweit die wichtigste Naturfaser, mit 24 bis 25 Millionen Tonnen2 und rund 20 Prozent Anteil am globalen Fasermarkt3 eine beachtliche Jahresproduktion erreicht, geht der Großteil davon in Bekleidung. Dort ist Baumwolle – ebenso wie Leinen – wegen ihrer Atmungsaktivität, Hautfreundlichkeit und ihres Tragekomforts besonders beliebt. Andere Naturfasern wie Jute, Flachs (Leinen), Kokos, Sisal, Hanf, Ramie und Kapok4 erreichen dagegen zusammen nur einstellige Prozentsätze an der jährlichen Faserproduktion. Daher fallen im Zusammenhang mit Naturfasern immer noch Begriffe wie „Nische“ und „Trend“. Dennoch zeichnen sich vielversprechende Entwicklungen ab. So nimmt die Bedeutung von Naturfasern angesichts eines zunehmend umweltbewussten Konsumverhaltens zu. Darauf deutet eine McKinsey-Umfrage aus dem Jahr 20205 hin: Von den mehr als 2.000 befragten britischen und deutschen Konsument*innen gaben 67 Prozent an, die Verwendung nachhaltiger Materialien sei für sie ein wichtiger Kauffaktor. Dass dieser Trend auch in schwierigen Zeiten anhält, zeigt eine Verbraucherstudie des Onlineportals Utopia aus 20246: Trotz des inflationsbedingten wirtschaftlichen Drucks bleiben demnach 44 Prozent der deutschen Bevölkerung ab 18 Jahren – und damit 3 Prozent mehr als noch 2022 – besonders offen für nachhaltige Angebote. Während die Gruppe der „gelegentlichen“ Käufer*innen nachhaltiger Produkte aufgrund der höheren Preissensibilität zwar leicht schrumpfte, blieb der Kern der nachhaltigkeitsaffinen Konsument*innen stabil.
Regulierung und neue Märkte treiben Nachfrage nach Naturfasern
Ein weiterer Treiber für den Einsatz von Naturfasern sind neue gesetzliche Vorgaben: „Insbesondere die EU-Textilstrategie und die steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen lassen das Interesse an Naturfasern wachsen“, sagt Stefan Schmidt, Fachbereichsleiter Technische Textilien & Referent für Forschung, Technik und Nachhaltigkeit beim Industrieverband Veredlung - Garne - Gewebe - Technische Textilien e.V. (IVGT). Auch der Verband der deutschen Heimtextilien-Industrie bestätigt den zunehmenden Einsatz von Naturfasern: „Wir sehen derzeit drei große Trends bei Heimtextilien: biologisch abbaubare Produkte, den Einsatz von Recyclingmaterialien und die vermehrte Nutzung von Naturfasern“, so Geschäftsführer Martin Auerbach. Dass sich Naturfasern gerade im Heimtextilbereich „wohlfühlen“, liegt unter anderem an der gröberen Garnstruktur von Heimtextilien. Sie ermöglicht neben Baumwolle den Einsatz einer Vielzahl anderer Naturfasern wie Hanf, Jute, Bananen- oder Kokosfasern. Ein weiterer Vorteil: Anders als bei schnelllebiger Mode sind Verbraucher*innen offenbar eher bereit, für langlebige Heimtextilien höhere Preise zu akzeptieren; laut einer länderübergreifenden Studie des Instituts für Handelsforschung in Köln aus dem Jahr 2023 sind rund 64 Prozent der befragten Konsument*innen.7
Mehrausgaben für Nachhaltigkeit
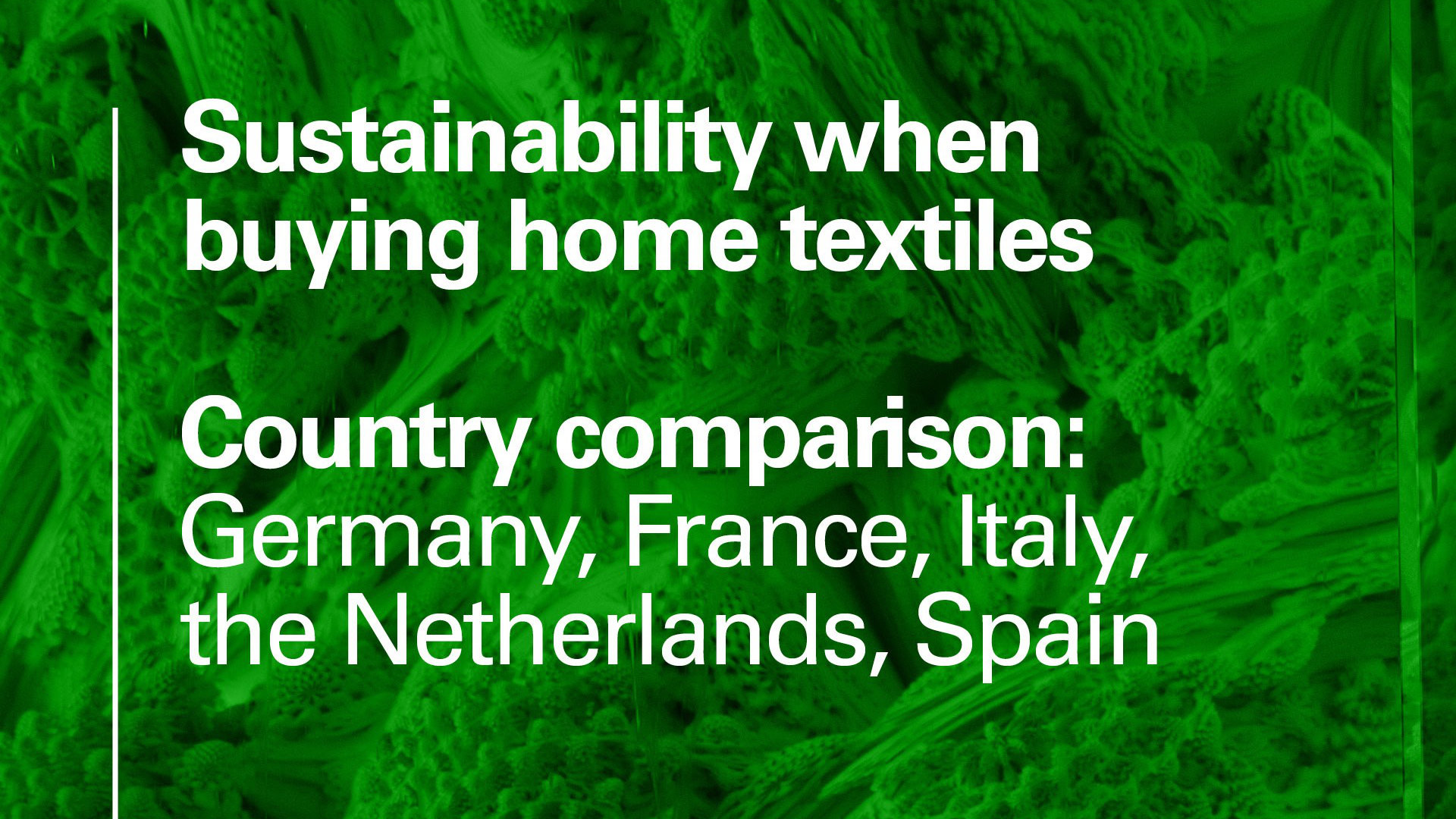
Insgesamt ist die Mehrheit der Konsument*innen (rund 64%) in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien bereit, für nachhaltige Heimtextilien mehr Geld auszugeben. Auf Länder-Ebene werden in Bezug auf Nachhaltigkeit beim Kauf von Heimtextilien deutliche Unterschiede erkennbar.
Technische Anwendungen als Zukunftsfeld
Gleichzeitig spielen Naturfasern ihre natürlichen Vorteile auch in technischen Anwendungen aus, zum Beispiel als Dämmmaterial, Erosionsschutzmatten oder biologisch abbaubare Verpackungsfüllstoffe als Alternative zu Styropor. Auch in der Automobilindustrie etablieren sie sich als umweltfreundliche Alternative zu Chemiefasern, vor allem im Innenraum oder in Form von Faserverbundwerkstoffen. Die Herausforderung: Als Naturprodukt unterliegen Naturfasern Schwankungen, was eine skalierbare Produktion bei gleichbleibender Faserqualität erschwert. Im technischen Einsatz punkten Chemiefasern weiterhin mit besserer Reproduzierbarkeit, Funktionalität und definierbaren Eigenschaftsprofilen. Doch innovative Herstellungs-, Verarbeitungs- und Veredelungsverfahren können dazu beitragen, die Qualitätsschwankungen der Naturfasern zu reduzieren und sie für immer mehr technische Anwendungen fit zu machen – insbesondere in Mischtextilien, die die funktionellen Vorteile von Chemiefasern mit der Umweltfreundlichkeit von Naturfasern verbinden.
Brückenschlag zwischen Funktionalität und Nachhaltigkeit
Um die funktionalen Unterschiede von Naturfasern auszugleichen und gleichzeitig nachhaltig zu produzieren, setzt die Textilindustrie auch auf einen dritten Weg: Chemiefasern auf Zellulosebasis (Man-Made Cellulosic Fibers: MMCF) aus nachwachsenden Rohstoffen wie Bäumen oder anderen Pflanzen. Die „halbsynthetischen“ Fasern, die industriell aufbereitet und chemisch in eine spinnfähige Form gebracht werden, nehmen eine Sonderstellung ein: Wie Naturfasern sind sie biologisch abbaubar und frei von Mikroplastik, wie Chemiefasern bieten sie konstante Qualität, Skalierbarkeit und definierbare Eigenschaften in Bezug auf Haptik, Festigkeit und Feuchtigkeitsmanagement. Dass die Nachfrage nach MMCF kontinuierlich steigt, lässt sich an der jährlichen Produktionsmenge seit dem Jahr 2000 ablesen: Lag die weltweite MMCF-Jahresproduktion damals noch bei 2,64 Millionen Tonnen (Industrievereinigung Chemiefaser)8, hat sie sich mit einem durchschnittlichen Wachstum von rund 5 Prozent pro Jahr bis 2023 auf 7,9 Millionen Tonnen (Textile Exchange)9 verdreifacht. Aktuell machen MMCF rund 6 Prozent des Weltfasermarktes aus. Mit einem Anteil von 80 Prozent dominiert Viskose (Rayon) den Markt neben Acetat, Modal und Cupro.10 Eine der bekanntesten Zellulosefasern ist Lyocell, die seit 1992 von der Lenzing AG unter dem Markennamen TENCEL™ vertrieben wird. Dass die Nachfrage nach Lyocellfasern auch im aktuell schwierigen Marktumfeld trotz hoher Preissensibilität steigt, bestätigt das österreichische Unternehmen: „Wir gehen derzeit von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 20 Prozent bei Lyocellfasern aus – damit ist Lyocell/TENCEL™ eine der am stärksten wachsenden Fasern weltweit.“
„Aktuell machen Man-Made Cellulosic Fibers (MMCF) rund 6% des Weltfasermarktes aus.“
„Das Hemd wird zur Kartoffel“
Insgesamt bieten Naturfasern und MMCF also ein großes Potenzial für die nachhaltige Transformation der Textilindustrie. Doch es gibt auch Herausforderungen: Anbauflächen müssen effizienter genutzt, ohne Konkurrenz zu Nahrungsmitteln ausgeweitet und klimabedingte Ernteausfälle durch zunehmende Extremwetterereignisse einkalkuliert werden. Gefragt sind verantwortungsvolle Anbaumethoden, etwa zur Optimierung der Wassernutzung beim Baumwollanbau oder bei der Wiederaufforstung von Wäldern. Lieferketten sollten idealerweise bis hin zur Fasergewinnung transparent sein, um echte Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht bei Anbau- und Produktionsmethoden, um zum Beispiel die schwankenden Qualitäten der Naturfasern auszugleichen, industrielle Standards für eine skalierbare und prozesssichere Produktion zu erreichen und die bei der MMCF-Produktion eingesetzten Chemikalien in geschlossenen Kreisläufen zu führen. Vor dem Hintergrund der auch bei biobasierten Fasern CO2-intensiven Transportwege sieht IVGT-Experte Schmidt Potenzial in der lokalen Wertschöpfung: „Die Wahl der Faser beeinflusst die Umweltbilanz des gesamten Textilprodukts. Für echte Nachhaltigkeit müssen wir ein Netzwerk von textilen Mikrofabriken aufbauen, die lokale Rohstoffe für die Fasern nutzen. Dann brauchen wir keine Kleiderbox mehr, dann landet das Hemd auf dem Kompost und wird im nächsten Jahr zur Kartoffel.“
Key Learnings
- Chemiefasern dominieren den Markt Chemiefasern punkten mit ihrer Verfügbarkeit, Vielseitigkeit und niedrigen Produktionskosten. Dem entgegen stehen der Verbrauch fossiler Rohstoffe, der hohe Energieeinsatz und die Freisetzung von Mikroplastik. Recycelte Varianten sind verfügbar. Ein echtes Faser-zu-Faser-Recycling ist noch wenig verbreitet.
- Naturfasern haben wachsendes Potenzial Vorteile sind ihre biologische Abbaubarkeit und CO2-Bindung. Umweltbewussteres Konsumverhalten und gesetzliche Vorgaben treiben ihren Einsatz voran, unter anderem bei Heimtextilien und technischen Textilien. Herausforderungen sind klimatische Abhängigkeiten und der skalierte Einsatz.
- Regeneratfasern als Brückenschlag zwischen Chemie und Natur Chemiefasern auf Zellulosebasis kombinieren die Vorteile von Natur- und Chemiefasern. Die Nachfrage danach wächst stark. Innovationen in Anbau und Produktion können Qualitäts- und Skalierungsprobleme lösen.
Quellen:
1 Textile Exchange, 2024, “Materials Market Report”
2 Textile Exchange, 2024, “Materials Market Report”
3 Statista, 2023, Verteilung der Faserproduktion weltweit nach Faserart im Jahr 2023
4 Statista, 2023, Verteilung der Faserproduktion weltweit nach Faserart im Jahr 2023
5 McKinsey, 2020, “Survey: Consumer sentiment on sustainability in fashion”
6 Utopia, 2024, „Alles bleibt anders“
7 IFH Köln GmbH, Dezember 2023, „Nachhaltigkeit bei Heimtextilien“
8 Statista, 2024, “Chemical fiber production worldwide from 2000 to 2022”
9 Textile Exchange, 2024, “Materials Market Report”
10 Statista, 2024, “Distribution of manmade cellulosic fibes (MMCFs) production worldwide in 2022”